MIZ 3/18: Revolution und Säklarismus
Mit der Novemberrevolution 1918 endete in Deutschland die Zeit der Staatskirchen. Die Suche nach der Rolle, die die beiden großen christlichen Kirchen in der Republik spielen sollten, gestaltete sich hingegen schwierig. Im Editorial der neuen MIZ verweist Chefredakteur Christoph Lammers darauf, dass der Kompromiss der Weimarer Reichsverfassung lediglich die gesellschaftliche Entwicklung nachvollzog, aber für die Lösung zukünftiger weltanschaulicher Entwicklungen nicht taugte. Da die einschlägigen Paragraphen Teil des Grundgesetzes sind, verwundert es nicht, dass bis heute der Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts als Instrument der Religionspolitik angepriesen wird, vor allem wenn es um die Integration „des Islams“ geht. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass Probleme einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts mit einem Modell, das die gesellschaftlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts abbildet, gelöst werden können.
Dass in den ersten Wochen der Revolution einige Schritte in Richtung einer Trennung von Staat und Kirchen erfolgten, war insbesondere einem Mann zu verdanken: dem Sozialdemokraten Adolph Hoffmann, der für kurze Zeit als preußischer Kultusminister agierte und von Horst Groschopp vorgestellt wird.
Für die Frauen brachte die Novemberrevolution das Wahlrecht, ihre Beteiligung an politischen Prozessen war jedoch noch gering, wie Gisela Notz zeigt. Auch eine zentrale Forderung, die nach Streichung des § 218 aus dem Strafgesetzbuch, konnte nicht durchgesetzt werden. Daniela Wakonigg leuchtet das Umfeld dieser Debatten aus und lässt eine Ahnung aufkommen, warum es bis heute noch nicht geklappt hat.
Gerhard Rampp blickt auf die jüngste Entwicklung im Missbrauchsskandal, in dem er längst einen „Vertuschungsskandal“ sieht. Wolfgang Proske setzt seine Beschäftigung mit der „Gottgläubigkeit“ fort und geht dabei auf die Zeit des Nationalsozialismus sowie den Bedeutungswandel ein, den der Begriff in der Zeit nach 1945 vollzogen hat. Und Gunnar Schedel stellt die Kontroverse über die Teilnahme humanistischer Organisationen an der #unteilbar-Demonstration dar.
Was Eltern ihren Kindern mit einer Impfung „antun“, ist Thema des Films Eingeimpft, über den sich Jan Oude-Aost einige Gedanken macht. Er beschreibt das Misstrauen der Eltern gegen die „Schulmedizin“ (was sie veranlasst, auf Impfungen zu verzichten) und das Misstrauen der Impfbefürworter gegen den Film David Sievekings. Er selbst (als klarer Impfbefürworter) hingegen schätzt den Film als im eigentlichen Sinne unvoreingenommene Auseinandersetzung mit dem Thema ein, wodurch eine Debatte angestoßen werden könnte.
Daneben gibt es noch die Rubriken Internationale Rundschau, Blätterwald, Zündfunke und die Glosse Neulich …
Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit auf der Webseite der MIZ.
Related

Am 26. November fand in der säkularisierten Alten Kirche Fautenbach die Gedenkfeier für Ur...
weiterlesen >

Zufrieden sind wir von der Leipziger Buchmesse zurückgekommen. Wie immer war viel am Stand los,...
weiterlesen >

Auf der Leipziger Buchmesse stehen Bücher noch im Mittelpunkt des Interesses. Während der ...
weiterlesen >

Anlässlich des 100. Jahrestags der Veröffentlichung der Duineser Elegien von Rainer Maria ...
weiterlesen >
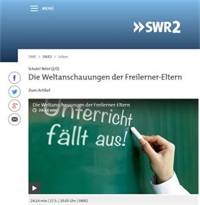
MIZ-Chefredakteur Christoph Lammers beschäftigt sich seit langem mit Bildungsfragen (u.a. geh&o...
weiterlesen >

Um die Situation säkularer Blogger in Bangladesch geht es im aktuellen Heft der MIZ. Deren Lebe...
weiterlesen >